KI-Modelle erfolgreich einführen
Im Rahmen einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom gaben mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen an, dass ihre Mitarbeiter dem Einsatz von KI skeptisch gegenüberstehen. Häufig bestehen etwa Berührungsängste oder die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Um diesen Vorbehalten zu begegnen, ist ein aktives Change-Management erforderlich. Bei KI-Projekten entscheidet somit nicht nur die Technologie über den Erfolg, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens, den kulturellen Wandel aktiv zu gestalten. Daneben sind noch weitere Kriterien maßgeblich für die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen.
Inhalt
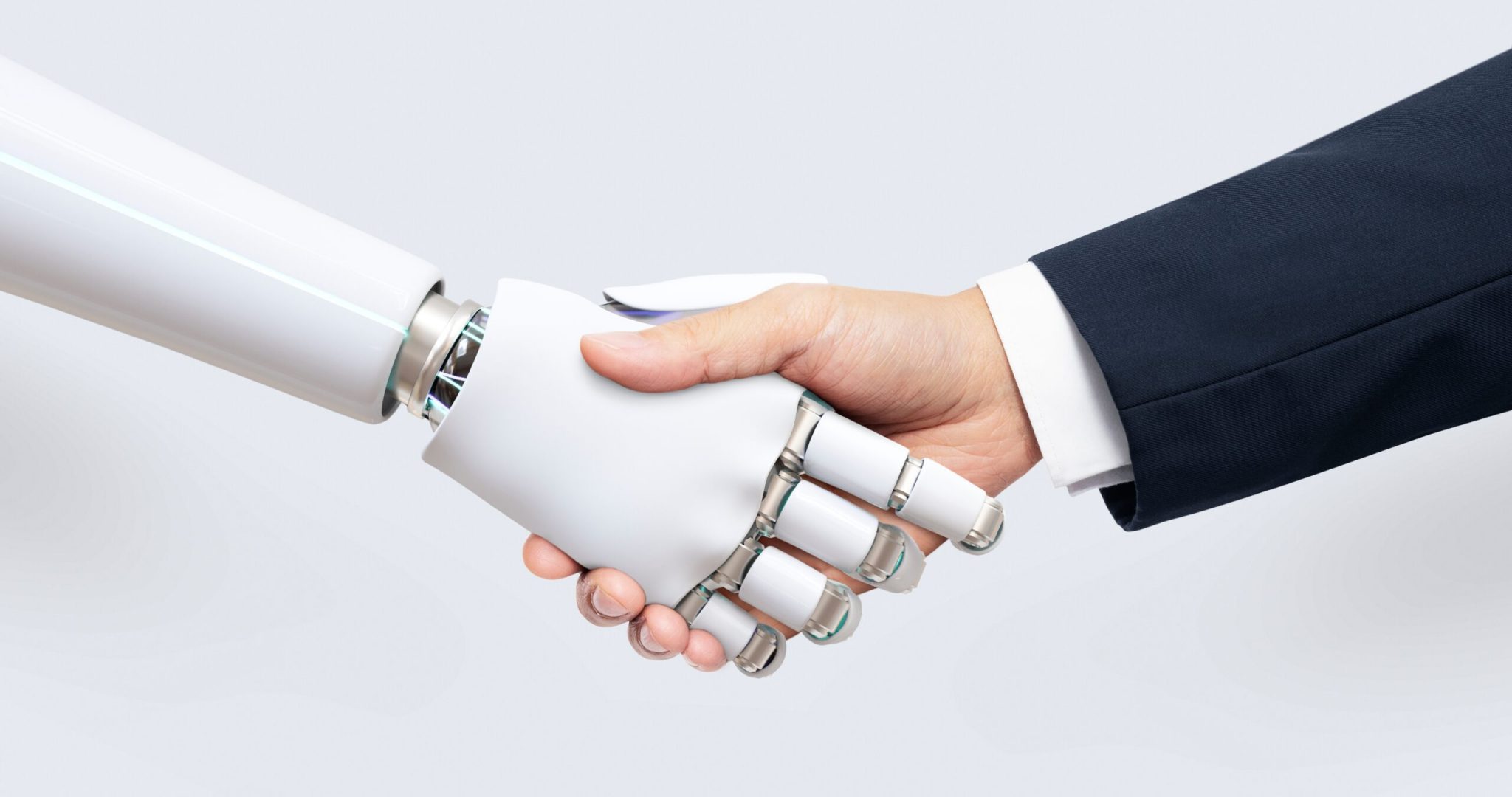
Change-Management gehört in jedes KI-Projekt
Die Einführung von KI verändert Arbeitsabläufe und Unternehmenskultur spürbar. KI-Modelle übernehmen Tätigkeiten, die bislang von Beschäftigten ausgeführt wurden – und das mit hoher Zuverlässigkeit, sofern sie gut trainiert wurden. Indes steht und fällt der Einsatz von KI mit der Akzeptanz der Mitarbeitenden. Ein wirksames Change-Management vermittelt ihnen klar, dass KI-Modelle Menschen nicht ersetzen, sondern sie stärken. Sie werden von repetitiven Aufgaben entlastet und haben somit mehr Zeit, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren.
Daher sollten Unternehmen ihre Beschäftigten und ihre Stakeholder frühzeitig über die Einführung von KI informieren und ihnen die Vorteile transparent aufzeigen. Neben Kick-off-Meetings empfehlen sich regelmäßige Meetings oder Newsletter während des Projektverlaufs, die über die erzielten Fortschritte informieren. Hinzu kommen Schulungen und Support-Maßnahmen, die dabei helfen, Berührungsängste hinsichtlich der KI-Modelle abzubauen. Die Geschäftsleitung sollte aktiv als Vorbild auftreten und sich gegenüber den Mitarbeitern und Stakeholdern klar zum Einsatz von KI-Modellen bekennen. Dies schafft Vertrauen und Akzeptanz.
Auswahl der passenden KI-Modelle
Der Markt bietet zahlreiche KI-Lösungen, von denen keine universell einsetzbar ist. Deshalb sollten Unternehmen zunächst die eigenen Use Cases identifizieren und anschließend die dafür geeigneten KI-Modelle – ob textbasiert oder grafisch – auswählen.
Bei der konkreten Entscheidung für eine KI-Lösung spielen dann weitere Kriterien eine Rolle, beispielsweise eine hohe Benutzerfreundlichkeit, verständliche Anleitungen oder die Unterstützung seitens des Anbieters, etwa in Form von Workshops. Auch Transparenz ist wichtig: Unternehmen sollten nachvollziehen können, wie das KI-Modell zu seinen Ergebnissen gelangt, und die Möglichkeit haben, die Resultate zu validieren und bei Bedarf zu korrigieren. Dies fördert mitarbeiterseits das Vertrauen und somit auch die Akzeptanz von KI-Modellen. Zugleich ermöglicht es einen kollaborativen Ansatz bei der Verfeinerung der KI-Leistung.
Zwingend ist zudem, dass das KI-Modell die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhält – unabhängig davon, ob es On-Premises oder in der Cloud betrieben wird. Unternehmen, die besonders sensible Daten verarbeiten – etwa Finanzdienstleister –, bevorzugen häufig eine lokale Installation. Sie sind dann gefordert, darauf zu achten, dass die Lösung performant in die vorhandene IT-Infrastruktur integriert wird.
Hohe Datenqualität sicherstellen
Selbst das leistungsstärkste KI-Modell kann keine guten Ergebnisse erzielen, wenn die Datenbasis nicht stimmt. Unvollständige, inkonsistente oder veraltete Daten bergen das Risiko von Halluzinationen, die bei geschäftskritischen Prozessen fatale Folgen haben können. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass KI-Modelle mit vollständigen, korrekten und aktuellen Daten trainiert werden. Bei der intelligenten Dokumentenverarbeitung gehören dazu sowohl die vorhandenen Dokumente als auch die daraus extrahierten Inhalte. Je höher deren Qualität ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die KI-Modelle aus künftig zu verarbeitenden Dokumenten die richtigen Erkenntnisse gewinnen.
Für eine verlässliche Klassifizierung müssen sowohl korrekt interpretierte Dokumente als auch ähnlich strukturierte, aber inhaltlich irrelevante Beispiele ins Training einfließen. Wiederkehrende Strukturen und Inhalte ermöglichen es der KI, Muster zu erkennen und akkurate Ergebnisse zu liefern. Die Unterstützung durch den Anbieter, zum Beispiel in Form eines interaktiven Portals, das Schritt für Schritt durch das Modelltraining leitet, versetzt selbst Anwender ohne technische Kenntnisse in die Lage, eigene Modelle zu trainieren.
Think big, start small
Hat sich ein Unternehmen für eine KI-Lösung entschieden, geht es im nächsten Schritt an die Einführung, für die sich der „Think big, start small“-Ansatz empfiehlt. Konkret werden dabei zunächst die zuvor definierten Use Cases im Hinblick auf ihr Automatisierungspotenzial analysiert. Vorrang haben Prozesse, die monotone, repetitive Aufgaben beinhalten. Sie werden sukzessive mit dem KI-Modell umgesetzt. Es folgt jeweils eine iterative Testphase, in der das Modell kontinuierlich Feedback erhält, wodurch sich dessen Leistung verbessert. Erst wenn die Ergebnisse die Erwartungen vollständig erfüllen, erfolgt der Roll-out und der nächste Prozess wird umgesetzt. Für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden gilt es, mit überschaubaren Use Cases zu beginnen und so schnelle Erfolge zu erzielen.
Mit uns als Partner an Ihrer Seite schaffen Sie die notwendigen Grundlagen für eine erfolgreiche Einführung von KI in Ihrem Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Identifikation geeigneter Use Cases sowie beim Change-Management mit Workshops und Trainings.
Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf!
